„Wir müssen die Gesellschaft zusammenhalten“
Pflege stärken, Strukturen verbessern, Kosten gerecht verteilen – wie das Gesundheitssystem die Corona-Krise bewältigen kann, diskutierten Pflegeexpertin Oberin Doreen Fuhr, AOK-Bayern-Chefin Dr. Irmgard Stippler, Ethikratsmitglied Professor Dr. Andreas Lob-Hüdepohl und NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann. Dabei ist ihnen auch die Solidarität über alle Bevölkerungsgruppen hinweg ein Anliegen.
Corona hat das Leben durcheinandergewirbelt – nicht nur beruflich, auch privat. Was beschäftigt Sie in der Pandemie persönlich am stärksten?
Doreen Fuhr: Im Frühjahr ist Corona für mich zu einer doppelten Herausforderung geworden. Als Mutter von zwei schulpflichtigen Kindern war der Lockdown mit Homeschooling und der zu bewältigenden beruflichen Arbeit extrem. Wir haben das als Familie gut gemeistert und gemeinsam überstanden. Umso größer ist die Besorgnis vor nächsten drohenden Schritten.
Irmgard Stippler: Mir geht es ähnlich: Ich habe mich darum gekümmert, dass meine Eltern – sie sind 83 und 87 Jahre alt – gut versorgt sind und sich gut schützen. Außerdem galt es, meine 15- und 17-jährigen Kinder schulisch zu begleiten und ihnen zu helfen, aus Rücksichtnahme auf die Älteren und Kranken ein Stück weit das normale Leben einzuschränken, wenn es beispielsweise um das Feiern, Freunde treffen oder den Sport geht. Wichtig ist, dass man in dieser Situation als Familie zusammenhält.
Andreas Lob-Hüdepohl: Von meinem Schreibtisch aus konnte ich auf einen leeren Schulhof, auf einen gesperrten Kinderspielplatz und auf einen Berliner Hinterhof sehen, in dem Kinder auf engstem Raum irgendwie zu spielen versuchten. Diese Form von Isolation und Verhinderung bei den Schwächsten hat mich die ganze Zeit beschäftigt. Zwar sind die Spielplätze wieder offen, aber inzwischen vereinsamen viele alte Menschen. Das tut mir weh.
Karl-Josef Laumann: Ich habe seit Anfang März fast kein Privatleben mehr, auch nicht am Sonnabend oder Sonntag. Immer gibt es irgendwo die nächste Herausforderung, die man bewältigen muss. Das hat das Privatleben völlig verändert. Auch ich habe in der Familie Menschen, die zu den besonders gefährdeten Gruppen gehören und um die ich mich sorge. Trotzdem meine ich, dass wir insgesamt bisher gut durch die Zeit gekommen sind.
Kommen wir zu Ihren beruflichen Themen. Stichwort Pflege: Wie wirken sich Applaus und Prämien auf die Motivation der Pflegekräfte aus?
Fuhr: Wir brauchen dauerhafte Anerkennung, keinen sporadischen Beifall. Wenn ein Berufsstand wie unserer länger vernachlässigt worden ist, lassen sich Verwerfungen nicht kurzfristig beheben. Es geht um die nachhaltige Verbesserung der Rahmenbedingungen in der Pflege: mehr Pflegepersonal, bessere Betreuungsschlüssel. Ja, auch ich bin zufrieden, dass die Öffentlichkeit durch die Pandemie auf uns Pflegende aufmerksam wurde. Aber wir müssen auch abseits von Krisen interessant bleiben. In den Kliniken und Pflegeeinrichtungen finden wir eine Personaldecke vor, die bereits ohne Pandemiesituation angespannt ist. Wir brauchen gute Arbeitsbedingungen: Es geht darum, Pflege zu stärken.

„Es geht um eine nachhaltige Verbesserung der Rahmenbedingungen in der Pflege: mehr Pflegepersonal, bessere Betreuungsschlüssel.“
Doreen Fuhr
Wie genau kann das aussehen?
Fuhr: Ich freue mich, dass in der Hauptstadt eine regionale Kampagne mit dem Titel PflegeJetztBerlin initiiert wurde: Hier bündeln alle Kliniken ihre Kräfte und drehen an verschiedenen Stellschrauben. Die Stärke herstellen, die uns in Krisen handlungsfähig bleiben lässt: Darum geht es uns Akteuren. Andere Pflegebündnisse wie der Berliner Pakt für die Pflege kämpfen für eine bessere Vergütung. Berufspolitisches Engagement darf sich nicht zufällig ergeben: Da sehe ich mich als Verantwortliche in der Pflicht, Freiräume zu schaffen, damit diese persönliche Arbeit geleistet werden kann und die Mitarbeit in Interessenvertretungen unserer Branche möglich wird.
Covid-19 lenkt den Blick nicht nur auf die Pflege, sondern auch auf die Krankenhausstrukturen. Viele Experten raten, die Zahl der Kliniken zu senken. Sprechen die Erfahrungen in der Pandemie dafür?
Laumann: Wir haben vor, im nächsten Jahr ein neues System der Krankenhausplanung zu etablieren: weg von der Bettenzahl als alleiniger Maßstab, hin zu Leistungsgruppen und Leistungsbereichen. Die Pandemie hat gezeigt, dass man die Krankenhauskapazitäten nicht auf Kante nähen darf. Gleichzeitig brauchen wir mehr Spezialisierung. Die Krankenhäuser sollten für alle gut erreichbar sein. Deshalb wird auch nach der von uns angestrebten Reform der Krankenhausplanung jeder Bürgerin und jedem Bürger Nordrhein-Westfalens weiterhin ein Krankenhaus mit Notfallversorgung in zumutbarer Erreichbarkeit zur Verfügung stehen. Örtliche Strukturen sind wichtig, um eine Pandemie zu beherrschen. Beispielsweise waren viele Testzentren in der Nachbarschaft von Krankenhäusern angesiedelt.
Stippler: Eine gute Krankenhausversorgung ist keine Frage der Bettenzahl. Unser Ziel ist eine stärkere Qualitätsorientierung durch Spezialisierung und eine Neuausrichtung der Strukturen. Mir ist zudem wichtig, Antworten auf die Frage zu finden, wie wir ambulante und stationäre Versorgung gut verzahnen können. Und die Strukturen müssen gerecht und nachhaltig gestaltet werden. Da hat jede Region andere Voraussetzungen, an die Weiterentwicklungen anknüpfen sollten.
Lob-Hüdepohl: Die Bettenzahl ist das eine und die ausreichende Qualität beziehungsweise die ausreichende Zahl qualifizierter Pflegefachkräfte ist das andere. Aktuell haben wir mutmaßlich ausreichend intensivmedizinische Betten. Ob wir auch genug qualifiziertes Personal verfügbar haben, ist eine andere Frage. Deshalb halten wir eine bestimmte intensivmedizinische Bettenkapazität vor und verschieben nicht ganz so notwendige Operationen.
Fuhr: Ich höre immer wieder: Zentralisierung hilft, den Pflegepersonalmangel zu beheben. Wenn aber ein Krankenhausstandort schließt und Kapazitäten neu strukturiert werden, dann wechseln die Pflegenden nicht unbedingt. Sie wollen ihr gewohntes Umfeld, ihre Identifikation mit dem Haus bleibt hoch oder sie finden das neu zugewiesene Arbeitsgebiet nicht unbedingt interessant. Die Pflegenden verfolgen eigene Pläne, ein Versetzenlassen gehört nicht immer dazu.

„Der Infektionsschutz und die Bekämpfung der Pandemie sind Aufgaben der Daseinsvorsorge. Hier hat der Staat eine finanzielle Verantwortung.“
Irmgard Stippler
Für die Krankenkassen bedeutet Corona an vielen Stellen Mehrkosten, beispielsweise für Tests oder die Vorhaltung von Intensivbetten. Wie lassen sich aus Sicht der AOK die Kosten und die Lasten gleichmäßiger verteilen?
Stippler: Es gibt eine einfache Regel: Aufgaben der Daseinsvorsorge trägt der Staat. Aufgaben der Krankenversorgung und der Pflegeversicherung übernehmen die Beitragszahlenden, also die Arbeitgeber und die Mitglieder der Kassen. Im Moment verschwimmt das ein bisschen. Der Infektionsschutz und die Bekämpfung der Pandemie ist eine Aufgabe der Daseinsvorsorge. Hier hat der Staat eine finanzielle Verantwortung. Hier dürfen nicht die Beitragszahlenden und die Unternehmen, die in die gesetzliche Krankenversicherung einzahlen, einseitig belastet werden. Auch die Umsetzung der Sozialgarantie 2021 – also die Deckelung der Sozialversicherungsbeiträge bei 40 Prozent – finden wir ungerecht, denn der Gesetzgeber greift dafür auf die Reserven der Krankenkassen zu und erhöht die Zusatzbeiträge. Das ist ein massiver Eingriff in die Beitragsautonomie der Krankenkassen und den Wettbewerb. Das müsste, wenn es politisch gewollt ist, über Bundeszuschüsse finanziert werden.
Laumann: Der Staat hat in erheblichem Umfang Steuergelder in den Gesundheitsfonds investiert. Wir lösen Reserven sowohl bei der Rentenversicherung, bei der Arbeitslosenversicherung und bei der Krankenversicherung auf. Unsere Regelung bei den Krankenkassen sieht vor, dass von dem Geld, dass über die Monatsreserven von 40 Prozent hinaus vorhanden ist, ein Drittel bei den Krankenkassen verbleibt. Das halte ich in der jetzigen Situation für vertretbar. Der Staat geht wegen der Pandemie-Kosten erheblich in die Neuverschuldung. Zudem hat der Staat dazu beigetragen, den Gesundheitsfonds in diesem Jahr über die Runden zu bringen. Zur Refinanzierung leerer Betten sind nach öffentlichen Aussagen rund zehn Milliarden an die Krankenhäuser geflossen.
Stippler: Das sind drei Punkte, auf die ich etwas erwidern möchte. Zunächst einmal: Die GKV hat in der Pandemie ihren Beitrag geleistet, um die Versorgung sicherzustellen und systemrelevante Prozesse in der Gesundheitsversorgung am Laufen zu halten. Zweiter Punkt: Wenn der Staat sagt, dass das Impfen und die Testung nicht aus Steuermitteln finanziert werden sollen, dann stellt sich die Frage, warum nur die gesetzlich Versicherten und nicht die privat Versicherten mit zur Finanzierung herangezogen werden. Und der dritte Punkt: Als ich vor sechs Jahren bei der gesetzlichen Krankenversicherung angefangen habe, betrug die Betriebsmittelobergrenze 1,5 Monatsausgaben. Das fand ich als Volkswirtin ganz vernünftig. Dann wurde die Rücklage auf 1,0 Monatsausgaben, dann auf 0,8 und jetzt auf 0,4 gesenkt. Wir müssen aufpassen, dass die finanzielle Stabilität in der GKV erhalten bleibt.
Von den Ressourcen der Kassen ein Schwenk zu den medizinischen Gütern und Dienstleistungen. Bisher haben sie gereicht, um alle an Covid-19 Erkrankten zu versorgen. Brauchen wir trotzdem ein Triage-Konzept, also Regeln für die Verteilung zum Beispiel von Beatmungsgeräten?
Lob-Hüdepohl: Wir sollten uns mit den Vorschlägen dazu auseinandersetzen. Wir haben zwar keinen Mangel an Beatmungsgeräten, aber andere Knappheitssituationen. Beispielsweise diskutieren wir ja über die Frage der Zuweisung von Impfstoff, weil wir relativ sicher davon ausgehen müssen, dass wir am Anfang nicht genügend haben. Für die Verteilung müssen wir nachvollziehbare, gerechte Kriterien entwickeln. Und die müssen wir auch kommunizieren, denn solche Priorisierungen entscheiden über Lebenslagen von Menschen. Die bisherigen Kriterien einer Triage, die wir aus der Notfallmedizin kennen, also die Einteilung nach Behandlungsbedarfen, reichen nicht mehr aus. Bislang galt: Wer als Erster lebensbedrohlich erkrankt die Klinik erreicht, bekommt auch die Therapie.

„Wir müssen Grundsatzentscheidungen den Parlamenten vorbehalten, denn dort sitzen die von der Bevölkerung und vom Staat legitimierten Vertreterinnen und Vertreter.“
Andreas Lob-Hüdepohl
Hier haben ärztliche Fachgesellschaften zwei Veränderungen eingeführt, die ich für problematisch halte. Die bessere Erfolgsaussicht soll nun ausschlaggebend sein. Das birgt ein großes Potenzial struktureller Diskriminierung von solchen Patienten, die entweder altersassoziiert oder vorerkrankungsassoziiert schlechtere Ausgangspositionen haben. Zudem ist der Vorschlag gemacht worden, dass immer, wenn neue Patienten eintreffen, die bereits in Behandlung befindlichen in einen Vergleich einbezogen werden. Das kann zu Behandlungsabbrüchen führen. Das halte ich für nicht legitim. Diese Form von Triage muss zunächst ausreichend diskutiert werden, und sie muss gesetzlich normiert werden. Der Deutsche Ethikrat hat sich dazu noch offen erklärt. Wir werden nachjustieren – immer in der Hoffnung, dass wir nie in eine solche Situation kommen.
Laumann: Meine Aufgabe als Gesundheitsminister ist es, dafür zu sorgen, dass wir in diese Situation gar nicht erst kommen. Am 13. März habe ich die nordrhein-westfälischen Krankenhäuser gebeten, Eingriffe zu verschieben, wo es medizinisch vertretbar ist. Kurze Zeit später sind Krankenhauskapazitäten frei geworden, weil die Liegezeiten so kurz geworden sind. Deswegen glaube ich, dass wir auch in Zukunft noch in der Lage sein werden, mit solchen milderen Mitteln an einer Entscheidung über Leben und Tod vorbeizukommen. Unser Gesundheitssystem ist so stabil, dass die Kapazitäten zur Behandlung aller Covid-19-Patienten zur Verfügung stehen.
Es gibt Hinweise darauf, dass Patienten mit anderen Erkrankungen wie beispielsweise Schlaganfall oder Herzinfarkt nicht oder verzögert in den Ambulanzen erschienen sind oder Menschen Früherkennungsuntersuchungen ausfallen lassen haben. Gerät die Behandlung von anderen Erkrankungen durch Covid-19 ins Hintertreffen?
Stippler: Zum einen belegen Zahlen aus dem Wissenschaftlichen Institut der AOK, dass die Zahl der geplanten Eingriffe zurückgegangen ist und so Kapazitäten für die Akutversorgung frei waren. Allerdings verzeichneten die Kliniken in der ersten Lockdown-Phase von Mitte März bis Anfang April auch einen Rückgang an Herzinfarktpatienten um 28 Prozent und Schlaganfallpatienten um 15 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Das muss jetzt analysiert werden. Unsere Aufgabe ist es, im Schulterschluss mit den Ärzten zu informieren und Menschen zu motivieren, dass sie, wenn es ihnen nicht gut geht, eine Praxis oder eine Klinik aufsuchen. Wir können Vertrauen in die Versorgungsstrukturen haben. Hier muss man den Menschen Ängste nehmen und bei Fragen zur Verfügung stehen.
Im Sommer waren wir erleichtert, dass die Infektionszahlen sanken. Jetzt sind wir wieder mitten in einer Infektionswelle. Zugleich müssen wir bedenken, wie wir künftigen Pandemien begegnen. Welche Lehren für die Zukunft lassen sich jetzt schon ableiten?
Laumann: Jetzt müssen wir erst einmal durch diesen Winter kommen. Die Situation wird anstrengend bleiben, bis wir einen Impfstoff haben, der in großen Mengen der Weltbevölkerung zur Verfügung steht. Bis dahin gilt: Wir müssen mit unseren Kontakten runter. In ein paar Punkten würde ich mir heute schon ein Urteil zutrauen: Die kommunale Verfasstheit von Gesundheitsämtern hat sich bewährt. Die Vernetzung auf Ebene von kreisfreien Städten und Landkreisen zwischen ambulantem Bereich und niedergelassenem Bereich, den Hilfsorganisationen und bürgerschaftlichem Engagement, aber auch den Krankenhäusern hat sehr gut funktioniert. Und: Es darf nicht wieder passieren, dass Schutzmaterial fehlt. Man muss unter Umständen bereit sein, ein bisschen mehr Geld auszugeben, um in den westeuropäischen Staaten mit eigenen Produktionsanteilen, etwa im Bereich von Schutzbekleidung und Medikamenten, die Versorgung zu sichern.
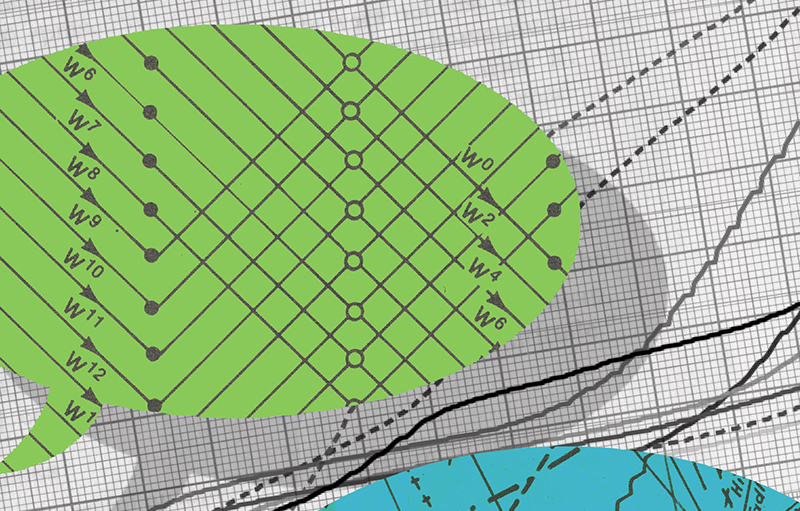
„Unser Gesundheitssystem ist so stabil, dass die Kapazitäten zur Behandlung aller Covid-19-Patienten zur Verfügung stehen.“
Karl-Josef Laumann
Sie haben gerade noch einmal betont, wie wichtig das Reduzieren der sozialen Kontakte ist. Das betrifft auch die Kontakte von und mit Pflegebedürftigen. Wie lässt sich eine Balance finden zwischen dem Bedürfnis nach sozialer Teilhabe und dem Infektionsschutz?
Fuhr: Das Recht auf soziale Teilhabe und auf regelmäßige Kontakte hat Priorität, auch jetzt. Es hat sich bewährt, mehrere Besuchsoptionen anzubieten, die zum jeweiligen Setting passen. Dabei sind immer die aktuellen Empfehlungen des Robert Koch-Instituts und – in Berlin – der Senatsverwaltung zu beachten. Alles funktioniert nur mit Abstand. Man muss die Besucher mit einer individuellen Terminvergabe und über Wegleitsysteme im Gebäude lenken. Und dafür benötigen wir ausreichend Personal, wie auch für Screenings und Datenerfassungen. Jetzt erkennen wir: Wer sich in der Vor-Corona-Zeit personell und organisatorisch ungenügend vorbereitet hat, steht in einer Krise wie jetzt vor großen Problemen. Das ist eine der wichtigen Lehren, die alle Beteiligten ziehen.
Sind das Themen, mit denen sich der Ethikrat beschäftigt oder beschäftigen sollte?
Lob-Hüdepohl: Wir beschäftigen uns gerade in einer eigenen Arbeitsgruppe mit den Folgen von Pandemien. Dabei geht es auch um ein Schutzkonzept für Menschen etwa in den stationären Einrichtungen der Alten- und Behindertenhilfe, denn sie haben ein signifikant höheres Risiko, lebensbedrohlich zu erkranken. Auf der anderen Seite verursachen diese Schutzkonzepte andere schwere Schäden, auch gesundheitliche. Es geht also um die psychosoziale Situation von Menschen in stationären Einrichtungen. In diesem Zusammenhang möchte ich darauf hinweisen, dass nicht von den Angehörigen das Hauptinfektionsrisiko ausgeht, sondern von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, weil sie zwangsläufig eine große Nähe zu den Pflegebedürftigen haben. Hier meinen wir, dass wir viel stärker in die Sicherungs- und Schutzkonzepte der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter investieren müssen, das heißt konkret: testen, testen, testen.
Besuchsverbote für Angehörige sind also keine Option?
Lob-Hüdepohl: Als das Besuchsverbot im Frühjahr 2020 gegriffen hatte, war die Sterblichkeitsrate unter den Bewohnern von Pflegeeinrichtungen dennoch weiter sehr hoch. Ich halte es deshalb für bedenklich, dass die Allgemeinverordnung des Landratsamtes Berchtesgaden im Oktober wieder Pflegeeinrichtungen für Besucher geschlossen hat. Dabei ist das Amt sogar über das Infektionsschutzgesetz hinausgegangen, denn danach müssen wenigstens seelsorgerische Kontakte ermöglicht werden, sofern Seelsorgerinnen und Seelsorger entsprechende Schutzkleidung tragen.
Wir kommen zur Schlussrunde mit einem Ausblick auf den Wahlkampf im nächsten Jahr, der von den Pandemiefolgen geprägt sein wird. Was ist im Hinblick auf die Bundestagswahl die wichtigste gesundheitspolitische Aufgabe?
Fuhr: Wir haben jetzt mehrfach über den Pflegepersonaleinsatz gesprochen. Ein Problem bleibt dabei für mich ungelöst: das Thema Leasing. Leasing ist für mich ein strukturelles Desaster. Mit jeder Pflegekraft, die statt der Festanstellung ein Leasing-Arbeitsverhältnis wählt, erhöhen sich die Lasten für das Stammpersonal in den Kliniken. Hier muss die Politik ansetzen, da wünsche ich mir ein aktives Gegensteuern. In Berlin bekommen wir die erforderliche Unterstützung durch das Engagement der Gesundheits- und Pflegesenatorin, aber auf der Bundesebene fehlen mir entsprechende Bekenntnisse.
Lob-Hüdepohl: Es muss gelingen, dass wir in Zukunft viel stärker, etwa im Rahmen eines Pandemiegesetzes, den Umgang mit solchen Großereignissen wie Corona gesetzlich normieren, einschließlich der Eingrenzung exekutiver Entscheidungen. Der Deutsche Ethikrat hat in seiner ersten Stellungnahme bereits im März darauf hingewiesen: Es ist vielleicht die Stunde der Exekutive, aber die Stunde darf nicht zu Monaten oder Jahren werden. Wir müssen solche Grundsatzentscheidungen immer der Legislative vorbehalten, den Parlamenten, denn dort sitzen die von der Bevölkerung und vom Staat legitimierten Vertreterinnen und Vertreter.
Laumann: Wir müssen die Gesellschaft über alle Altersgruppen und wirtschaftlichen Interessen hinweg zusammenhalten. Die Menschen sind von der Pandemie sehr unterschiedlich betroffen. Viele haben am Monatsanfang genau das gleiche Gehalt auf dem Konto wie vorher. Aber es gibt auch sehr viele Berufe, die vor einer wirtschaftlich schwierigen Situation stehen. Da denke ich beispielsweise an Schausteller oder Messebauer und an die vielen Menschen, die wegen Corona Kurzarbeit haben. Es muss uns gelingen, Solidarität zu erhalten. Wir dürfen nicht vergessen, dass es Menschen gibt, um die wir uns sehr kümmern müssen und dafür die notwendigen finanziellen Ressourcen zur Verfügung stellen, damit nicht einzelne Gruppen durch die Pandemie unter die Räder kommen.
Stippler: Da möchte ich direkt anknüpfen. Eine leistungsstarke und stabile gesetzliche Krankenversicherung leistet einen Beitrag dazu, dass alle Menschen in Deutschland den gleichen und guten Zugang zur Gesundheitsversorgung haben. Die Politik muss alles dafür tun, das aufrechtzuerhalten. Wir brauchen finanzielle Stabilität, die nachhaltig gesichert werden muss, damit wir unseren Aufgaben nachkommen können. Dafür brauchen wir verlässliche Rahmenbedingungen und einen solidarischen Wettbewerb, denn der sorgt dafür, dass wir mit den Beitragsmitteln gut umgehen. Wir brauchen bedarfsgerechte Versorgungsstrukturen und regionale Gestaltungsspielräume. Das sollte die Politik ermöglichen und sichern, damit wir alle gemeinsam Verantwortung übernehmen können.
Das Gespräch moderierten Karola Schulte und Änne Töpfer Ende Oktober in einer Videoschalte.
Die Teilnehmer:

Oberin Doreen Fuhr, Diplom-Pflegewirtin, ist seit 2012 Vorstandsvorsitzende der DRK-Schwesternschaft Berlin, dem alleinigen Gesellschafter der DRK Kliniken Berlin.

Professor Dr. Andreas Lob-Hüdepohl, Moraltheologe, ist seit 2016 Mitglied des Deutschen Ethikrates. Er leitet das Berliner Institut für christliche Ethik und Politik.

Dr. Irmgard Stippler, Diplom-Volkswirtin, ist seit 2018 Vorstandsvorsitzende der AOK Bayern. Zuvor hatte sie dasselbe Amt bei der AOK Rheinland-Pfalz/Saarland inne.

Karl-Josef Laumann, CDU, ist seit 2017 Gesundheitsminister von Nordrhein-Westfalen. Zuvor war er Staatssekretär im Bundesgesundheitsministerium und Pflegebevollmächtigter.